Wie man weiß, spricht man heute nicht nur in Deutschland gerne von Wende. Mit einem ganz speziellen Exemplar einer solchen scheinen wir es bei der sogenannten Wende vom linguistic turn zum body turn zu tun zu haben. Eine abermalige Wendung und Faltung, die verstärktes Interesse für materielle Grundlagen entwickelt. „Materialität des Diskurses“, „Konstruktionen von Geschlechtlichkeit und dazugehörigen Körpern“, „Materialität des Diskurses“, „Konstruktion epistemischer Dinge“, „Körper-Politik“. Zu diesen avancierten Methoden, die von der Epistemologie bis zur Laborwissenschaft, von der Literaturwissenschaft bis zur Ästhetik reichen, gibt es zahlreiche oft genannte – und einige weniger genannte oder verschwiegene – Traditionslinien, die in diesen Bemühungen verlängert, intensiviert oder einfach nur wiederholt, angewandt, zuweilen aber auch unterfordert werden. All dies wendet sich gegen die Hysterie wie auch Begeisterung, die bezüglich der vulgären Vorstellungen von Simulakra, Überflutung mit Bildern, Wirklichkeitsverlust durch allumfassende Medialisierung, virtuelle Realität und autistische Selbsteinschließung in zyklische autopoietische Systeme und dergleichen mehr vorgebracht wird. Soweit dies auch löblich sein mag, zeigt sich aber auch hier trotzdem, dass der einmonierte Körper oftmals in den Rastrierungen von Bildlichkeit, Gestalt und Figur usw. aufgefasst wird. Dies gilt auch für eine Materialität, die von einem szientifischen konstruktivistischen Bild derselben ausgeht. Zwischen erkenntnistheoretischer oder epistemologischer Beschreibung und so genannten Körpertechniken, -praktiken und -politiken liegt ein beinahe noch ungedachter Bereich, den man vorläufig mit den Namen Sophisten, Stoiker, Leibniz, Spinoza und dem englischen Empirismus in Verbindung bringen könnte und der von Gilles Deleuze in eigenartiger Weise rekonstruiert wurde. Eine Kartographie von Körpern auf der Immanenzebene, verlässt eine in Hegel ihren Abschluss gefunden habende Logik genau so, wie die Vorstellung einer kausalen Körper/Gestalt-Doublette, sowie deren etwaigen affektiven Potentialen. Anstatt nun die Mangelhaftigkeit irgendwelcher theoretischer Wissensansätze mit einem solchen Denken zu konfrontieren, werden wir lediglich einigen, vielleicht auf den ersten Blick etwas esoterisch oder verquer anmutenden Zügen auf dieser sich entwickelnden Ebene folgen.
I.
Niemand hätte jemals ernstlich angenommen, schreibt Malcolm Lowry in einem Brief, dass Kafkas Landvermesser ein Land vermesse oder solches beabsichtige. Denn dieses Land scheint keine begrenzbare Zone zu sein, schon gar keine begrenzte Anlage. Eines seiner Namen mag Hölle sein und im Herzen liegen und einer der sich zu seiner Erkundung aufmacht wird nur träumend einen Pfad sehen, den er doch niemals gehen wird können. (1) Auch werden alle Einwohner der Umhegungen und Behausungen belästigt, wenn nächtens eingebildete Besucher ihre Namen in verächtlichem Ton rufen, Spinette der Finsternis anschlagen, ein nimmermüdes Raunen durch die Ritzen und Zwischenräume dringt. Es darf daher wohl vorläufig darauf geschlossen werden, dass da draußen etwas unterwegs ist, dem man nicht von vorne herein Gutes zu unterstellen bereit ist.
Stellen sie sich also vor, sie treffen schon in ihrem Treppenhaus nicht auf ihren Nachbarn – der einem auch nicht immer geheuer sein muss – sondern auf eine winzige Figur, die vielleicht am Treppengeländer lehnt und nichts zu tun zu haben scheint. Sie sieht aus wie eine sternförmige Zwirnspule, aus deren Mitte ein Stäbchen ragt, das durch ein weitere an seinem Ende, im rechten Winkel angebracht, und auf zwei Zacken des Sterns gestützt, zu stehen vermag. Diese Figur macht einen ziemlich abgerissenen Eindruck, einige verfilzte Fäden heften ihm an, andere hängen lose und einzeln herunter. Ein solcher Geselle scheint sich auch ziemlich unverfroren in ihrem Haus seit geraumer Zeit herumzutreiben, obwohl sie ihn manchmal lange nicht zu Gesicht bekommen, weil er offenbar in anderen Häusern die Einwohner verwirrt. Fragt man ihn wie er heiße, so sagt er Odradek und dies muss wohl sein Name sein, obgleich niemand weiß, wer ihn ihm gab. Scheinbar schadet er niemanden, aber man weiß auch nichts rechtes mit ihm anzufangen und rätselt, wozu (und ob) er gut sein könnte, sieht man ihn doch keiner geregelten Arbeit nachgehen. Schmerzlich schleicht sich dann auch schon einmal die Sorge ein, er könne einen überleben, da er doch so ohne jedes Ziel zu sein scheint und ohne jeden Zweck; daher auch nicht durch diese aufgerieben werden kann. Sollte er, wenn sie längst das Zeitliche gesegnet haben, seine Zwirnsfäden hinterher schleifend sogar noch vor ihren Kindern und Enkeln die Treppe herunterkollern und dabei seinen Spaß haben?
Erfreulich ist das nicht, aber gibt es Grund zur Sorge? Oder ist es gar doch erfreulich, humorvoller und weisheitsferner als man aufgrund des ersten Blicks annehmen könnte? Gar eine Geste des Denkens par excellence? Doch wollen wir beim Anfang beginnen, beim Namen.
Unheimlicher noch als der An- und Ausruf, der lockt oder höhnt und von Draußen kommt, scheint, dass er nichts anderes ist als ein Eingeborenes, das mir von anderswo her, exkarniert, zuruft. Es ruft mich ein Name, den ich nicht als meinen oder den meinesgleichen (an) zu erkennen vermag (und der noch aufdringlicher ist, als wenn er der meine wäre) und meine Sorge richtet sich danach, zu verstehen, was er mir sagt oder was er mich heißt. Was aber, wenn ich, mit welchen Mitteln auch immer, anders zu hören begänne? Wenn man sich des krampfhaften Lauschens auf irgendwelchen rationalen Sinn und irgendwelches mythischen Raunen entschlagen würde? Denn vielleicht ist der Name bloße Entstellung und Exposition, der man sich über Interpretation nicht nähern kann, eine Geste, die immer bloß zeigt, was nicht gemeint war, ein Monstrum ohne Monstratum (Hamacher). Von daher benennt er dann weder einen Sachverhalt noch ein Monument, ebensowenig ein Ereignis. Er ist eher die Chiffre einer Begriffsperson, nichts was zu nehmen oder zu übernehmen wäre – auch mag er eine eine Experimentalanordnung auf der Immanenzebene sein, ein Rieseln im Gefüge. Der Name übt eine Doppelagententätigkeit aus, die ihn zugleich zum Designator und Träger (suppôt) macht, die in keinem ordentlichen symbolischen Rentabilitäts- oder Versicherungszusammenhang ruhig gestellt werden kann. Wie sich im Zug des Sprechens Unausgesprochenes spricht, übersetzt das Spiel von Name und Anonymität das Spiel von konturierter Gestaltgabe und Entstellung. Beispielen mag sich dies also vorläufig am Namen Odradek. An dem Namen, der nicht zuletzt den Hausvätern immer wenigstens merkwürdig, zuweilen höchst unheimlich schien. Dieser nimmt sich nicht nur seltsam aus, sondern klingt auch fremdartig. Hermeneuten und Etymologen (wie Hausväter, Hausvermieter und Hausbesorger, zuweilen auch Hausparteien nun einmal so sind) wünschen klare Verhältnisse und Bezüglichkeiten, wünschen daher weit mehr als Erklärung oder Beschreibung, einen ordentlichen Herkunftsnachweis, sozusagen die Vorlage aller Urkunden die man so braucht, Meldebestätigung, Eintrag ins Geburtsregister etc. Wollte man dabei auch sicherheitshalber erstmal einmal versuchen zu übersetzen, um zu erfahren wo dieser herkomme und vielleicht daraus ableiten, was ein solcher, der er einen solchen Namen trägt, verbergen oder verheimlichen wolle, könnte man auf das tschechische Wort „odraditi“ stoßen, was soviel wie „abraten“ heißt. „Rád“ findet sich im Deutschen auch als „Rat“ wieder. Nimmt man nun die Silbe „Od-“ als Präfix (weg von, ab) heran und nimmt das Suffix „-ek“ als Verkleinerung, so erhält man ein kleines Wesen, das abrät, oder immer abrät. (Ein solches würde also, würde es befragt und aufgefordert, Kundschaft zu geben, mit „Ich möchte lieber nicht“ antworten.) Eindrucksvoll und beeindruckend hat Werner Hamacher (2) gezeigt, wie kurz solches trägt. Zuerst wäre um einiges zu ergänzen: „rada“ läßt sich mit Rat, Reihe, Zeile, Richtung, Rang und Linie übersetzen, „rád“ mit Reihe, Ordnung, Klasse, Regel, geraten und ratsam, daher „rádek“ mit kleine Reihe, Linie, Zeile. Somit wäre Odradek dasjenige, „was außerhalb der sprachlichen oder schriftlichen Ordnung, außerhalb der Rede, abgetrennt von der Ordnung des Diskurses, außerhalb jeder genealogischen und logischen Reihe, als Verräter jeder Partei und jedes erdenklichen Ganzen sein Unwesen treibt“. Wenn also der Hausvater, um der Genealogie und der Ökonomie des Sinns willen, die genetische Deutung von Odradek als unsicher und unzutreffend verwirft, dann wie er selbst sagt, mit Recht, denn Odradek heißt Apostat – Apostat vom Kontinuum der Generation, der Linie, des Rechten, der Rede, der Ratio, der Logik. Jede Deutung von Odradek, die den Anspruch auf Sicherheit, Schlüssigkeit und Sinn erhebt … muß Odradek verfehlen, weil Odradek Dissidenz und Dissens und Ausscheren aus der Ordnung des Sinns bedeutet und also ,bedeutet‘, dass es nichts bedeutet. Seine Rede sagt, daß er sie in Abrede stellt, daß er ent-redet. Sein Name heißt, dass er nicht heißt. Und deshalb hilft’s auch nichts, Kafka (die Dohle also) durch dass gespiegelte d auf den Raben gekehrt aus der Schachtel zu ziehen. Od-rade-K/Od-Rabe-K. Auszudeuten als von der Wurzel (radix) sich abwendend und ausweichend, sich vom Initial des K lösend, vom Stamm (aber nicht vom Rhizom) abfallend, als „odrodek“, als Ab-Art und als aus der Art Geschlagenes vazierend, als „odranec“, Lumpenzeug und Haderlump, als Abgerissenes, „odrati“ oder „odranka“, einem Stückchen Papier, Flickwerk, oder gar als Odrácek, als draconicus, als Monstrum. Doch gleichzeitg scheint sich in Odradek der merkwürdige, geheimnisvolle, vielleicht gefährliche, vielleicht erlösende Trost des Schreibens, das Herausspringen aus der Totschlägerreihe (Kafka) zu be- und zu entnennen. Er ist aber, soweit er denn ist, nicht allein Sprung im Gefäß, im Gefüge der normativen Stellungen der Rationalität (Hamacher), sondern auch affizierender Körper, sich entwickelnde Spule, die eher verfranst und kollert, als wie am Schnürchen ab- oder hin und her zu laufen. Die Besorgnis des Hausvaters ist also nicht unberechtigt. Dieser wird aus der von ihm eingeforderten Position des Garanten einer symbolischen Ordnung oder hermeneutischen Interpretation entsetzt. Der Hausvater wird gerade seiner Garantie (auctoritas) und seines Garant-seins des „ater“ (als anagrammatische rate, rat) und seiner als rechtmäßig eingeforderten Verstehensprinzipien beraubt, aus ihnen exiliert und in ein Dunkel (ater) weggerissen. Im lungenlosen verantwortungslosen Lachen Odradeks, das an das Rascheln gefallener Blätter erinnert, deutet sich ein sur-vivre, ein Über-Leben, an, dessen Zukunft und Zukünftigkeit nicht in die Register der Genealogie, symbolischen Ordnung oder der allgemeinen sinnvollen Rede der Aussagesätze fällt. Sie ist die Geste des Übergangs von Sprache in Nicht-Sprache und damit auch eine Geste der Philosophie. Es ist die Geste eines Werdens, die der Geste der Philosophie inhäriert. Der Denker wird Azephaler, Aphasiker, Analphabet, wie Artaud sagt, aber er hört auch nicht auf sie zu werden, um diese aus der Agonie zu reißen, sie dem auszusetzen, wo etwas vom einen zum anderen übergeht. (3) Fremdwerden in der eigenen Sprache, sich von der Attraktivität eins solchen Kollerns, Stolperns und Stotterns mitreißen zu lassen, heißt Stil haben und Lachen können – was bekanntlich dasselbe ist. Somit sind diese Prozesse des Werdens, die auch den Namen Odradek konturieren, der aber nichts heißt und uns nichts heißen kann, ohne Geschichte. Weil Odradek eine Begriffsperson ist, hat er (?) keine Geschichte, und das gibt dem Denken auf zu bezeugen, das heißt (gestaltlos) zu verkörpern, dass es selbst experimentell ist und daher nach einer Seite hin Ereignis. In diesem vollendet sich aber nichts, und es ist auch nicht Grundlage eines neuen Anfangs. Das Unmenschliche der Sprache ist dort am vehementesten, wo wir selbst noch aufhören davon zu berichten, wie es die Sprache wäre, die spräche. Kafkas Bewegung ist so eine Fluchtbewegung durchs Menschliche hindurch ins Unmenschliche. Es traversiert dabei eine Zone des Nicht-Sterben-könnens als das Niemandsland zwischen Mensch und Ding. In dieser Zone begegnet sich Odradek, den Benjamin als einen Engel Kleeschen Stils betrachtet, mit Gracchus (wobei man hier anmerken sollte, dass Gracchus auf italienisch eben Dohle bedeutet, das bescheidene Nachbild Nimrods). Dabei protokolliert sich nicht in erster Linie eine soziale Genese der Schizophrenie, sondern zu fragen wäre, was das für eine Höhlung und Höhle ist, was für eine Krümmung. Ein Hohlraum mit Funken (Bloch) geht auf, der sich in die Körper eingefräst hat. Eine dübellose Bahnung in den Wänden, Hölzern und Fleischen. Sind es nicht vielmehr Bauanleitungen für Einflußapparaturen, wie Victor Tausk das schon 1919 in einem Aufsatz beschrieben hat? (4) Und darüber hinaus bezeugt sich wohl eher der Vorteil, dass weder der kleine Odradek noch wir Engel sind und uns auch nicht hinter ihren Flügeln zu bergen haben. Denn weil uns die Flügel fehlen, sind wir vor der möglichen Illusion des Anblicks einer einzigen Katastrophe (aber auch des einen ordentlichen Gesetzes mit seinen Mauern,, die sich vor uns auftürmen) erlöst. Erlöst von der Katastrophe, die von einem Sturm verursacht sein soll, der aus dem Paradiese her anweht und zwar so stark, daßss die (oder der) Engel der Geschichte seine Flügel nicht mehr zu schließen vermag, die zu Segeln eines letalen Kurses aufgespannt sind. Wir haben zuletzt nichts damit zu tun – mit dem Wunsch ums Verweilen zu ringen, aber es nicht zu können, Tote zu wecken, aber auch das nicht zu können, Zerschlagenes zusammenzufügen … (5) Wir können den Wind durch die geöffneten Finger streifen lassen, wir können uns schlank machen, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, wir können uns abwenden oder auch rücklings in eine Grube kollern. Wir können uns winzig machen, um im Auge des Taifuns keinen Widerstand zu bieten und irgendwann drauf kommen, dass vielleicht gar kein Wind weht, schon gar kein Sturm, sondern bloß frische Brise. (Obgleich man dafür manchmal ein paar Gläser trinken und viel (auch Schund) lesen muss, auf dass dann zuweilen ein Verwandter Odradeks erscheint, der Angel of the Odd, der uns Kirschwässer einflößt, uns ans Unwahrscheinliche glauben macht, und der uns schilt, wenn wir nicht glauben wollen, was geschrieben steht. Ein Engel aus alten Flaschen und Fässern, der nicht mit einem Huhn, einer Eule, einem Kobold oder dem „Head-Teuffel“ verglichen werden möchte, die im Gegensatz zu ihm sehr wohl Flügel haben. Er ist einmal Edgar A. Poe erschienen, der von ihm zu berichten weiß.) Das Gebannte und der Bann sind abgefallen und im Experimentieren erzeugen sich Werkzeuge und Maschinen, von denen wir noch nicht wissen, wozu sie nütze sind. Implantate und Prothesen, die sich in mannigfacher materieller Beschaffenheit in unseren Körpern einsetzen. Das Experiment ist weder einer Wiederholbarkeit, noch einer endlichen Utopie der Zweckursachen überlassen, sondern es insistiert und subsistiert – da, gerade jetzt –abweichend von der Geschichte. Und dabei kommt ihm Odradek entgegen oder führt es brausend und stolpernd an, Agent einer littératur mineur, einer kleinen, oder besser kleiner-werdenden Literatur. Einer Sprache die odrhetorisch (Hamacher) ist, die sich als Gesetz einer Singularität verzeichnet, die allein in ihrer Nicht-Exemplarität exemplarisch ist, die Abweichung von nomos, Ökonomie, Einwohnung und Ansässigkeit, Rationalität und Genealogie ist. Sie ist als diese Abweichung eingesetzt in die großen Sprachen, die referentiellen und Sprache sprechenden, sie fragmentiert jede Figur und Gestalt, indem sie sie desœuvriert und konturiert. Anfangslose Basis einer scheiternden ins-Werk-setzung. Sie ist nicht Freiheit, sondern Ausweg oder Flucht (aber nicht Flucht vor oder aus …), Schaffung eines Körpers, der weglaufen kann oder auch nicht – was zuweilen gar nichts macht. Beim fröhlichen Bau solcher anders gearteten Ausdrucksmaschinen spricht sich nichts mehr. Auch nicht die Sprache selbst; sondern es erlöst sich Spalt, Zweck und Ende auf eine Falte der Immanenz hin, auf die fröhliche Philosophie eines „Es ist nichts geschehen, fürchtet euch nicht, habt keine Sorge“ hin …
Weniger hohl sein also, als Hungerkünstler-werden. Sich seinen Leib im Käfig aushöhlen, auf den der Familienvater zeigt und den die Kinder aus der schlechten Vorbereitung von Schule und Leben nicht zu deuten vermögen. Der Vater ebensowenig, da er sich bloß an die Geschichte erinnert, wo er selbst Kind war und ein Hungerkünstler noch ein angesehener Mann. Doch wenigstens glänzt es ein bisschen in den Augenhöhlen der Kinder, aber wer mag sich auf solcherlei Zukunft verlassen. Und als der Hungerkünstler nun endlich stirbt, in einem Zirkus, für den er schon lange keine Sensation mehr darstellte und nicht einmal mehr die Täfelchen verändert wurden, die anzeigten wie lange er schon hungere, da warf man ihn samt seines Strohs aus dem Käfig in ein Grab, und das dumme Volk staunte nun ob eines schwarzen Panthers, der nun in den so frei gewordenen Käfig einzog und angeblich Freiheit und Kraft besaß, dem es an nichts mangelte, nicht einmal an dieser Freiheit, die ihm nämlich irgendwo im Gebiss zu stecken schien, mit dem er aus lauter Lebensfreude die Happen in sich hineinschlang. Doch der andere war schon längst entsprungen in die Illuminierung seines Leichnams (wie Kafka in einem Brief über sein Schreiben andeutet), in die Kryptonymie eines Überlebens, das sich einer Aushöhlung, einer Stülpung, verdankt, in der die Funken nicht für Feuer und Brand geschlagen werden, sondern für ein Irrlichtern.
Wenn sich also paradoxerweise der geschlossene Immanenzzusammenhang als die Flucht aus Gefängnissen konkretisiert, so ist die Listigkeit (und nicht die Weisheit, gar eine demütige) der Ausweg des Denkens. Ihm werden dann die Schlupfwinkel der Kindheit, die verlassenen Stätten, wie die des Treppenhauses im Gegensatz zu den Interieurs, in denen die Menschen hausen, zu Stätten der Hoffnung. „Die Auferstehung der Toten müßte auf einem Autofriedhof stattfinden. Die Schuldlosigkeit des Unnützen setzt den Kontrapunkt zum Parasitären. … Nach dem Zeugnis von Kafkas Werk befördert in der verstrickten Welt jegliches Positive, jeglicher Beitrag, fast könnte man denken die Arbeit selbst, die das Leben reproduziert, bloß die Verstrickung.“ (Adorno) Wenn die Schöpfung – und nicht die Arbeit –den Vorrang übers Lebendige (also das positiv Gegebene und Seiende) erringt, so geht dies nur mit und durch das Überflüssige und Überlebende. Es sind die Diversifikationen eines Namens und nicht die lebendige Seele, die fürs unsterbliche Teil stehen. Keineswegs also war Kafka der Klassiker des Stehenbleibens bei der blinden und panischen Angst vor der Wirklichkeit, wie Lukács ihn beschrieb, sondern er war ihr Experimentator. Er setzte auf ein Unzerstörbares und Überlebendes, wenn auch etwas anders, wie das der Freund Brod mythisierend vorstellte. Seine Körpertexturierungen, Metamorphosen, die sich immer in zwei Serien entwickelten, setzten auf das Bauen von Fluchtmaschinerien. Ausgangspunkt war eine implizite Verkehrung dessen, was man bislang vom Körper dachte.
II.
Die Freiheit besteht einzig in der Macht sich gegenüber anderen Körpern zu behaupten oder auszudehnen, positiv affiziert zu werden. Der conatus als Beharren und Werden in affektiver Passion koppelt so die Achse einer kinetischen Sammlung, welche die Identität der Singularitäten bezüglich ihrer relativen Geschwindigkeit und Langsamkeit qualifizieren und der Achse, die eine dynamische Macht graduiert. Die Konsistenz eines Körpers bestimmt sich daher aus der Gesamtsumme der materialen Elemente, die ihm unter bestimmten Bedingungen der Bewegung und Ruhe, der Geschwindigkeit und Langsamkeit zukommen und der Gesamtsumme der intensiven Affekte zu denen er bei gegebenen Grad des Potentials fähig ist. Die beiden Serien stehen daher in keinem wie auch immer gearteten zwingenden Kausal- oder Gattungsverhältnis und sind daher auch keiner taxonomischen, rentablen oder rationalen Interpretation oder Vermessung zugänglich, sondern ihre Arten und Weisen der experimentellen Herstellung von konsistenten materialen Ensembles bei höchstmöglicher Fähigkeit zu affizieren und affiziert zu werden, werden geschätzt. Dies führt eben dazu, dass man nicht wissen kann, wozu ein Körper fähig ist, wozu er werden kann. Körper-Singularitäten sind daher einerseits in ihrem Inneren einer krasis, also Mischung, unterstellt und zugleich im sich-differenzierenden Verhältnis zu anderen Singularitäten. Aus der krisis eine krasis machen, verfolgt keine billige Auswechslung, auch nicht von Buchstaben, sondern problematisiert einen Tonwechsel, erfindet sich also ein altes Problem neu. Wo es nicht mehr darum geht, der Materie eine, womöglich ideelle, Form aufdrücken zu wollen, sondern konsolidiertes Material zu entwickeln, das als Folie immer intensiverer Kräfte (und Diversifikationen) funktionieren kann, dort kann man sich auch nicht mit den Figuren von Unterscheidung, Negation und Aufhebung zufrieden geben. Chrysipp entwickelte für die antike Stoa zuerst einen Mischungsbegriff, der sich entscheidend von dem der Atomistik abhob (die darunter nur die Aneinanderlagerung kleinster Partikel verstand) oder der symmetrischen strukturellen Logik eines Verhältnisses von Mangel und Überschuss (zum Beispiel Pore/Körper) etwa bei Alexander von Aphrodisias oder Lukrez. (6) Chrysipp unterschied genauer drei Arten von Mischung. Grundsätzlich muss dabei zuerst eine Unterscheidung zwischen Vermischung (mixis) und Mischung (krasis) bestimmt werden, wobei die letztere als vollständige Durchdringung verstanden wird. (In englischen Übertragungen findet sich daher das Wort blend und in französischen das Wort Melange.) Die stoische Auffassung der krasis verläuft ebenso nicht völlig analog zur aristotelischen Theorie der Mischung, die streng genommen auch nur eine der Vermischung (mixis) ist und weniger auf die Durchdringung, als auf eine Kombinatorik und Verbindung abzielt, die wiederum bezüglich der einzelnen Kombinationsbestandteile entweder reversibel oder irreversibel sein kann. In stoischer Auffassung bleibt bei der mixis die Individualität der Bestandteile (ein Haufen Bohnen und Weizenkörner) erhalten, wobei als Ergebnis einer solchen Vermischung der Körper natürlich neue Qualitäten annehmen kann, da auch hier gilt, dass eine solche Neugestaltung mehr als die Summe der Bestandteile ist. Andererseits kann und muß eine Art der mixis beschrieben werden, die zerstörerisch ist, wenn sie in der Neuzusammensetzung eines oder mehrerer Körper (so etwa die Mischung eines Arzneimittels aus mehreren Bestandteilen) deren Individualität(en) unwiederbringlich zerstört und sie in einen neuen Körper übergehen lässt. (Gorgias hat dies auch für das Verhältnis von Körper und Reden als affektives Verbundverhältnis von Drogen, pharmakoi, schon in der Sophistik beschrieben.) Eine solche Bewegung ist dann irreversibel, und die Ausgangsbestandteile können nicht wiederhergestellt werden. Der Mischungstypus von krasis stellt dagegen einen besonderen Fall dar. Chrysipp versteht darunter die Mischung des formlosen pneuma mit der Materie, wobei keine der beiden ihre Qualitäten im eigentlichen Sinne verliert und sich dabei doch völlig durchdringen. So ist zum Beispiel das Seelenpneuma aus dem Übergang von Feuer zu Luft entstanden und schuf so eine völlige Durchdringung in einer Mischung von Seele und Körper im/zum Leib. Dieser Vorgang setzt Material und Form, Körper und Seele in einer disjunktiven Synthese zusammen und zwar nicht derart, dass zwei getrennte Entitäten verfugt würden, sondern beide sind Aspekte eines kontinuierlichen Verbundes, der ihre je eigene Körperlichkeit ermöglicht und nur über diese gewusst werden kann. Zum einen durchdringt das pneuma alle Körper vollständig, zum anderen ist das pneuma Agent der Verbindlichkeit und Interaktion des Universums, nämlich aufgrund seiner Fähigkeit zur aktiven, dynamischen und kreativen Veränderung der Körper. Schon hier muss also auf die Problematik verwiesen werden, dass pneuma selbst paralogisch verfasst scheint. Stellt es doch zum einen eine kontinuierliche und homogene mediale Substanz dar, als Kraft und Ursache der Kohärenz jedoch, also als Differenzierendes und Differenziertes, ebenso eine zusammengesetzte. Dies ist nun aber nur solange ein zulässiger Einwand, wie Homogenität und Differenzierung (von einer Logik der Identität (Substanz) – Differenzierung (Begriffsarbeit, verweilen beim Negativen) – Reidentifikation (Begriff), also einer zyklischen Selbstbesonderung) als notwendige Gegensätze oder Entwicklungsstufen betrachtet werden. Durch den Rückgriff auf den tonos als Erzeuger eines Spannungsfeldes, versuchten die Stoiker, Dichtigkeiten, tonale Spannungsfelder und tonales Werden zu denken. Das pneuma steht unter der Spannung (tonos) einer Vibration, die vom Zentrum des jeweiligen Körpers an seine Peripherie übertragen wird. In seiner vollständigen Durchdringung der Materie vitalisiert und schafft es so Qualitäten und durchdringt als Feld (näherungsweise könnte man von einer stehenden Welle sprechen), alles was ist. Der tonos verbindet dabei die individuierten Einzelteile ebenso in sich selbst, wie diese untereinander zu strukturellen Einheiten. Die Spannung ist eine gedoppelte. Sie richtet sich von den Körpern nach außen und schafft fraktionierte Quantitäten und Qualitäten; in ihrer Ausrichtung ins Innen der Körper schafft sie Einheit und Substantialität derselben. Expansion und Kontraktion in stetem Wechsel ist die kreative Leistung des pneuma. (Hier liegt auch der Unterschied zu Aristoteles, der für die Bewegung einen kontinuierlichen leeren Raum denkt, der selbst aber, anders als für die Stoiker, keine Eigenfunktion als Medium besitzt.) Die Materie in dauernder Bewegung stuft sich in unterschiedliche Organisationsstufen ab und dies ist eine Frage der pneumatischen Intensität und der tonalen Spannung in ihren Aufrissen von Verzeichnisebenen und Verkörperungen. Logos, physis, psyche und hexis (als strukturelle Haltekraft) sind daher Aufzeichnungsflächen dieser tonalen Spannungen. Wenn sich pneuma und Materie nun vollständig durchdringen, zugleich aber beide Körper sein müssen, so wird das Strukturproblem, daß nicht zwei Körper zur selben Zeit an/in der gleichen Stelle anwesend sein können dadurch umgangen, daß sich das pneuma durch seine ganz besondere Feinheit und Dünnheit, seine Leichtigkeit und Flüchtigkeit auszeichnet. Es ist mit anderen Worten überflüssig, unmerklich und zeigt sich auch nur in den und durch die von ihm penetrierten Körper der Materie an.
Wenn im antiken Stoizismus nur dem Körperlichen das Prädikat des Seienden zukommt, da das Unkörperliche (etwa Ort, Zeit, das Leere und das Ausgesagte, lekta ) weder etwas tun noch etwas erleiden kann und nur Körper agieren, reagieren, leiden und interagieren, können, so müssen die Bestandteile der krasis die Fähigkeit haben, aufeinander zu wirken (poiein) und voneinander zu leiden. Leeres Unkörperliches ist daher weder der Behälter, noch ein Ur-sprung, sondern ein Phantasma der Körper. Körperliches wird vom Unkörperlichen körperlich durchdrungen und somit sag- und anschreibbar, Unkörperliches wird durch das Körperliche hindurch inkorporiert. Unkörperliches entsteht nur durch Körperliches. Das aktive Prinzip, das diese Beweglichkeit erzeugt, vereint, verteilt und vermittelt, sind die logoi und pneuma. Einzelkörper entstehen dank der tonikè kínesis. Das Weltganze, in das diese Körper eingebettet sind, heißt für Chrysipp denn auch dynamis pneumatiké. Im phantasma gelingt es, konvergierende Serien und singuläre Ereignispunkte so zusammenzudenken, dass sowohl eine Mathematik singulärer Punkte, wie auch eine Physik intensiver Quantitäten sich verwebt. (Also die Verhältnisse von Textilem, Gewebe, textum, Bau und Architektur und textur, räumliche und zeitliche Anordnung als Gefüge, befragt werden können.) Die sich in diesem Gewebe herstellende Resonanz ist seine tonale Verfasstheit, die nicht ursprünglich oder originär ist, sondern Effekt der disjunktiven Synthese der, zumindest doppelten, Serien und der Konstitution von singulären Ereignissen. Der von „Fall zu Fall neu organisierte Illusionsraum der Sprache“ (Deleuze) und des Textes ist somit der Bedeutungshof einer strukturalen Grammatik. Dort ereignet sich, von Fall zu Fall eben, das Poetische, rückgebunden in die Spannung der Webungen einer symbolischen und strukturalen Ordnung und einem esoterischen Privatismus der singulären Punkte, welche sich beide einer vollständigen Grammatisierung entziehen. Folglich handelt es sich also um ein übergreifendes Zusammenwirken in diesem System ohne zentrale Steuerungseinheit, also um ein emergentes System. Die Seele oder vielmehr das hegemonikon, welches die Körper organisiert und agogisch leitet, muss in sich selbst organisch gedacht sein, könnte bestenfalls als vitales Zentrum beschrieben werden. Wiewohl dieses Kraftzentrum das Feld organisiert, schlägt es selbst immer wieder in verschiedene Zustände um, kann ebenso mehrere verschiedene gleichzeitig annehmen. Es ist ein hegemonikon in einem je spezifischen Zustand, das ebenso diakritisch, trennend und lösend verfährt wie zugleich, sammelnd und stabilisierend.
Das emergente System der heimarmene (fatum) ist mit dem pneuma, dem überflüssigen Agenten der Kopplung, identifiziert. Hier stellt sich dem Hausvater eine Ethik der oikeiosis auf. Lebensgabe und Erhaltungstrieb (die Passion eines Austrags der stasis) desselben Lebens als Umgang in einer mehrfältigen Ökonomie. Der Sinn fürs kalon dieses Umgangs, der gute Blick, ist affiziert von der Spannung aisthesis und oikeiosis, also von einer Verteilung und Verbindung des Außen und Innen, Selben und Fremden. Sinnvoll können darüber nur die logoi verhandeln, und diesen sich angehören lassen führt zu den diversen Formungen und Modulierungen. Die Drehungen und Wendungen (tropé, tropos) dieser Beweglichkeiten sind für die Bedingung der Möglichkeit nicht nur dieser Erkenntnis verantwortlich. Was also sich vorlegt ist ein System, das durch einen chaotischen Attraktor beschrieben wird und selbst dann ein zufallsartiges Verhalten aufweist, wenn alle beschreibenden Gleichungen streng deterministisch sind. „Tatsächlich erzeugen diese Gleichungen einen Attraktor, welcher weder einen Punkt (stationärer Zustand), noch einer geschlossenen Linie (periodisches Verhalten), sondern einem dichten Ensemble (meistens in Verbindung mit einer ,fraktalen‘ Dimension) von Punkten entspricht. Obwohl jeder Punkt eines chaotischen Attraktors das Ende einer möglichen Systementwicklung darstellt, besitzt dieser Endzustand nicht die Stabilitätseigenschaften, welche gewöhnlich einen attrahierenden Zustand kennzeichnen. Eine kleine Variation der das System beschreibenden Parameter kann ausreichen, um das System in einen völlig anderen Zustand zu überführen. Die Evolution auf den Attraktor zu zeigt sich ganz besonders empfindlich gegenüber jeder Änderung der Anfangsbedingungen. Da die Beschreibung eines makroskopischen Systems auf den flukturierenden Mittelwerten basiert, bedeutet das, daß ein durch einen chaotischen Attraktor beschreibendes System ohne Ende von Zustand zu Zustand irrt.“ Damit ist der Gegensatz von Zufälligkeit und Notwendigkeit erledigt. (Das fatum erscheint als eine Doublette von Experimentaltechniken des Willens zur Macht und der Entwerkung der Gefüge im selben Zug.) Dort wo man alle Ausgangsbedingungen streng deterministisch nachweisen könnte, bliebe nicht mehr zu sagen als das, was die Grenzen dieser Voraussetzungen wären. Umgekehrt aber ermöglicht ein Ensemble zufällig erscheinender Messwerte deterministische Evolutionsgleichungen aufzustellen. Nun gilt längst nicht länger der parmenideische Satz allein, dass alles Gedachte faktisch seiend sein müsse, sondern nur unter der Prämisse der nietzscheanischen Wendung, dass alles, was gedacht werden kann, gewiss Fiktion sein müsse. Der harmos ist dann die Faltung eines Umschlags, einer gegenstrebigen metabolé. Damit kommt es auch zu einem Ton(art)wechsel und -umschlag, zu einer metabolé des nomos, die sozusagen immer die Umverteilung, Neumischung, von phantasmatischen Elementen innerhalb von geschlossenen Strukturen um ein Gelenk herum, oder angetrieben durch einen nachträglich bestimmten oder gewußten Katalysator, arrangiert. Wenn dabei die gegenstrebige Mischung in Sicht bleibt, widerstrebt man der schon platonischen Forderung, nur den Musiker in den Staat aufzunehmen, und wohl nicht nur den Musiker, dessen Tonart ungemischt (akratos), also frei von metabolai sei. Innerhalb der Immanenz der pneumatischen und tonalen Mischung bleibt metabolé eben auch der Umschlag von einer Tonart (nomos) in die andere, von einem Rhythmus in den anderen, innerhalb des gleichen Dithyrambos. Das fatum also zu lieben und zugleich umzuprägen, das heißt hier auf den Willen zu setzen, ist eine paradoxe Drehung. Nur sie kann eine Verwindung bewerkstelligen, die sich weigert, zu den Weisheiten eines reaktiven Buddhism abzusinken und zugleich sich weigert, sich den Redundanzen der Negation zu ergeben. Diese Liebe ist dann notwendig Liebe zum Text, zum Wort, zum Buchstaben, zur Zahl – zum Fernsten und zugleich nächsten -: Philologie.
Die phantasia erfüllt so bei den Stoikern eine Doppelfunktion. Sie strukturiert Verhältnisse zu Körpern, ist dabei aber insoweit selbst körperlich, als sie auf logoi verpflichtet ist. Diese wiederum sind selbst gedoppelt, da das Aussagende, sei es als Stimme oder Schrift, zwar körperlich ist, das Ausgesagte (lekton) aber eben nicht. In einem solchen Sprachdenken kann Sprache dann keine Abdeckung und Abschirmung gegenüber einer angstmachenden und traumatisierenden Körperwelt liefern, weil dieser Abgrund je immer schon in sie hineingemischt ist. Der Doppelfunktion einer Neutralisation, welche die Zumutungen des Körpers und die überfordernden Ansprüche der Sprache (Kamper) gewährleistet, kann nicht mehr nachgekommen werden. Der Schrecken und seine vermeintliche Domestikation durch logifizierendes Archivieren hat sich in diesem Bereich selbst eingenistet. Wenn sich also die menschliche Einbildungskraft in Mimesis und Simulation spaltet, der Substitutionsgehalt der Bilder überhand nimmt und die Ausgeburten der Phantasie sich auf die technischen Bildmedien unter beständiger Reproduktion verlagern, so kann der Tendenz nach die Imagination zwar zur Waffe werden, körperliche Mimesis und technische Simulation (das Feld des Politischen, das niemals ein rein mimetisches ist) werden aber in ihrer Amalgamierung auch gegenwendig verschränkt und austauschbar. Zu fragen ist dabei nach der Kraft dessen, was aufmischt, also nach dem virtus des Virtuellen. Die Bejahung dieser Kraft ist keine Destruktion, oder Neuschaffung, sondern Transformation des bislang Erreichten durch Bejahung der Immanenz. Dies spielt sich in der Zone zwischen den Serien zu, in metaxy, die aber kein Reich des Geistigen und der Teilhabe (metexis) ist, sondern Zone des Über-Lebens, der Mit-teilung. Dort wird nach einem Stil gesucht, der nur Zeichen ist, „in memoriam“, nach radikaler Entpersönlichung von Stil und Perspektive, die sich nicht immer aufs neue Resituieren, auch zumal unter der Form des Zwischen und des lebendigen Menschen aufmacht. Jedes Schreiben vor allem aber glückendes, schreibt fortan nicht von etwas, sagt etwas (etwa die „Sprache spricht“), heißt etwas, sondern es ist dieses etwas, indem es sich selbst aufweist und die Anerkenntnis eben dessen entzieht.
III.
Begriffe sind Singularitäten, die sich durch eine eigentümliche Unendlichkeit und Konsistenz darstellen. Sie entwickeln sich auf der Immanenzebene, die sich durch die Nacht schneller Bestimmungen fräst. Nach der einen Seite sind sie unendlich in ihrer Geschwindigkeit, nach der anderen konturieren sie fragmentarische Komponenten der eigenen Begriffsbestimmung. Die Verbundkontextur einer Begriffsmaschinerie erzeugt somit nicht Kommunikation zur Bildung von Universalien (aber auch nicht zum rentablen Benennen von Pseudoereignissen), sondern die diversen Verbindlichkeiten von Mitteilungen, in dem sie Fluchtlinierungen ausprägen. Zugleich entlang wenigstens zweier Wellen-Serien entlang einer Hauptfluchtlinie können so Begriffe/Singularitäten fabriziert werden, die sich dann immer zu anderen differenzierend verhalten, in sich eine flexible und liquide Konsistenz ihrer Komponenten, die selbst zu Begriffen werden können, ausbilden und das Kondensat ihrer eigenen Komponenten darstellen. Solche Zwiefalt und Zwischenfaltung (Deleuze) teilt sich mit, ist Mitteilung, nicht häusliche Kommunikation, teilt das Geteilte, differenziert die Differenz. Es expliziert und kompliziert sich daher im selben Zug, in diversen Registern der reinen Virtualität ein Werden. Das bedingt dann, dass nicht ein Körper etwas tut oder realisiert, sondern dass sich in oder an ihm sich etwas tut oder realisiert, wodurch er wird, was er ist. Das Schaffen von Begriffen, die Aufgabe der Philosophie, ist daher auch nicht abzulösen von ihrer Kehrseite, dem (er)finden von Problemen. Dreh dich um, schau zur Seite, stell die Frage anders, lass deine eigenen Stratageme und Meteore auf dich einschlagen, melancholisch gesprochen: Strategien der Selbstruinierung (Kamper). Im Experiment entschränkt sich so eine Passion. Ihre Maschinen sind nicht immer schon künstlich genug, und können es auch ad limine nicht sein, um dem Überleben gleichzukommen, das mit der Tödlichkeit der reinen Fluchtlinie zuletzt immer koinzidiert. Alle organischen und anorganischen Maschinen und ihre Programme sind Kreuzungen und Faltungen, Traversierungen, dieser reinen Fluchtlinie. Begriffe, Singualritäten und Körper bleiben daher nach Innen und Außen Heterogenese, eine Anordnung von Komponenten durch und in Nachbarschaftszonen, sie sich in Entwicklung befinden, also von Seite zu Seite oder aber von Falte zu Falte übergehen. Die Immanezebene ist daher blättrig (wenn die Fräse gut geschliffen), da sie solcherlei Begriffe in ihrer Bewegung ausdrückt. Sie macht uns lachen, auch wenn es nach fallendem Laub klingen mag, da der Humor selbst eine Erfahrung der Immanenz ist (Stengers). Sie erlaubt uns keinerlei Kompromisse mit der Transzendenz eingehen zu müssen und uns nicht bei Differenz oder Pluralismus fälschlich zu beruhigen. Im Koexistieren von Ebenen der Begriffe, ihrer Milieus, bezeugt Philosophie, indem sie solche Begriffe schöpft und dem Werden aussetzt, die Immanenzebene, die immer im Spiel ist und alles Denken affiziert, ohne deshalb Grund des Denkens zu sein, das sich bloß auf ihr aus und zuträgt. Sie ist immer dann da, wo etwas von einem zum anderen übergeht. Um Kunst zu machen braucht es nur das: „Ein Haus, Stellungen, Farben, Gesänge – vorausgesetzt, dass das alles auf einen verrückten Vektor wie ein Hexenbesen hinflüchtet und davonbraust: eine … Deteritorialisierungslinie.“ (7) Dort wo die Wissenschaft Sachverhalte konstruiert, die Philosophie durch Begriffe Ereignisse zum Erscheinen bringt, da errichtet die Kunst Empfindungsmonumente. Jedes dieser Hauptmilieus des Denkens kann mit jedem anderen an unterschiedlichsten Stelle unterschiedlichste Beziehungen eingehen. Sie können einander stabilisieren, auslöschen oder steigern. Bezogen bleiben sie doch auf eine Immanenzebene, von der aus sie ihre Ebenen abmessen und ausstecken, in denen sie ihre jeweiligen Körper schaffen. Dieser Zug überlässt sich einem Vektor der Geschwindigkeit und trotzt ihm die fragilen Konturen ab, die sich dann von diesem Trotz befreien können und scheinbar ganz von alleine davonlaufen. Doch in allen diesen Experimenten verfügen sich die Faltungskatastrophen (Thom), die aus den Grauzonen der Milieus herrühren. Zwar ist im Stoff Formtrieb und hart im Raume stoßen sich noch seine Sachen, „als die einzigen, die greifbar. In der Täuschung wars häufig besser als beim Aufwachen, und was es zeigt, darin leben wir … So ist der Stoff auch und gerade in seinem da unbeendet und zeigt das im Abstand vom nicht nur sinnlichen Glänzen und Füllen, das von ihm herrührt.“ (8) Der Formtrieb begrenzt sich aber nicht allein in solchem Möglichen, das sich auf ein Anti-Nihil, die Utopie, spannt, sondern entwickelt sich als ein strategisches Umherirren im Werden der Immanenz, also von Falte zu Falte. Im großen Turn of the Screw ist somit nicht auf den Bohrer zu vergessen, da das Verhältnis Kopf und Wand als stoßender Vor- und Rückgang mit der Beule der Erfahrung aufgeht. Doch Erfahrung ist nicht das von uns bedachte Experimentieren, das uns ermöglicht, nicht-falsche Täuschungen, non-falsi errori (wie Dante dies nannte) herzustellen und uns in sie einzufügen. Man gleitet zwischen den Dingen und den Falten, verbindet sich mit ihnen, nistet sich ein, zwingt sich ihnen auf oder passt sich ihnen an. Man schafft so keine Aneignungen oder Einverleibungen, sondern diverse Verbindlichkeiten mit anderen (und auch mit sich), paradoxe Soziabilitäten, implantiert in die Mitteilungsgemeinschaften (und nicht in die Communio) und wird in solche implantiert. Kurz eine Technik, die nichts mehr von sich weiß, ein Denken, dessen Innerstes ein eingesetztes Äußeres ist, dessen Außen ein exkarniertes Innen. Es ist die eine Geste, wie sie Hans Bellmer in allen drei Ebenen, der Konstruktion von Sachverhalten, der Errichtung von Monumenten und dem Erscheinenlassen von Begriffen verwirklichte.
„Mit dem bis zum Brechreiz vertrauten Werkzeug des Ingenieurs wird plötzlich ein Mißbrauch getrieben, der es unwiderruflich kompromittiert. Der Vater ist besiegt. Er sieht, wie sein Sohn, mit einem Bohrer bewaffnet, den Kopf eines kleinen Mädchens zwischen die Knie seines Bruders zwängt und sagt: ,Halt sie fest, ich muß ihr die Nasenlöcher durchbohren.‘ Blaß geworden geht der Vater hinaus, während der Sohn seine Tochter betrachtet, die jetzt atmet – als sei es verboten, das zu tun.“ (9)
Eine Weise zu leben, gespannt jenseits des Glaubens und der Weisheit, ein splitterndes Experiment, das seinen Zweck und sein Ziel im Zuge der Anfertigung vergisst. Solches tun hat vergessen und bekümmert sich nicht länger um das Gedächtnis einer „Rükkehr zum Seyn“, durch eine Sprache als angeblich namengebender Kraft, als seyender Gegenstand, der als seiender aus dem Ich heraus geboren wird, wie es Hegel in seiner Jenenser Realphilosophie nannte. Diesem Gedächtnis ientspringt man, wie auch Odradek entsprungen ist – und hier trifft zu, was Walter Benjamin von ihm schrieb: er „ist die Form, die die Dinge in der Vergessenheit annehmen.“ (10)
(1) „I wonder if it is because to-night my soul has really died that I feel at the moment something like peace. Or is it because right through hell there is a path, as Blake well knew, and though I may not take it, sometimes lately in dreams I have been able to see it?“ Malcolm Lowry, Under the Volcano, London 1990, S. 36.
(2) Vgl. Werner Hamacher, Die Geste im Namen. Benjamin und Kafka. S. 280 – 324. In: Ders., Entferntes Verstehen. Ffm. 1998.
(3) Vgl. Gilles Deleuze / Félix Guattari, Was ist Philosophie?, Ffm. 1996, S. 127.
(4) Vgl. Victor Tausk, On the Origin of the „Influencing Machine“ in Schizophrenia. In: the Psychoanalytic Quarterly (2/1933).
(5) Vgl. Walter Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, in: Ders., Sprache und Geschichte, Stuttgart 1992, S. 146.
(6) Vgl. Alexander von Aphrodisias, De mixtone, S. 78ff., in der erstmaligen Übersetzung und Kommentierung von Friedemann Rex, Chrysipps Mischungslehre und die an ihr geübte Kritik in Alexanders von Aphrodisias De mixtone. Ffm. 1966. Ebenso Lukrez, De rerum natura. Berlin 1972. Die Fragmente Chrysipps finden sich in Johannes von Arnim, Stoicorum veterum fragmenta, Bd. II, S. 18ff. (Logik und Physik) und Bd. III, S. 3ff. (Moral). Stuttgart 1964.
(7) Vgl. Gilles Deleuze/Félix Guattari, Was ist Philosophie?, Ffm. 1996, S. 219.
(8) Vgl. Ernst Bloch, Über Freiheit und objektive Gesetzlichkeit, im Prozeß gesehen, in: Ders., Philosophische Aufsätze zur objektiven Phantasie, Ffm. 1969, S. 532.
(9) Jean Brun, zit. nach Constantin Jelenski, Hans Bellmer oder Der widernatürliche Schmerz, in: Hans Bellmer, Die Zeichnungen von …, Berlin 1969, S. 6.
(10) Walter Benjamin Franz Kafka, in: Ders., Gesammelte Schriften II.2. Ffm. 1977, S. 431.
Andreas L. Hofbauer, lecture given March 9, 1998. (Academy for Applied Arts, Vienna. Wiener Gruppe, Lacan, Sektion Ästhetik)













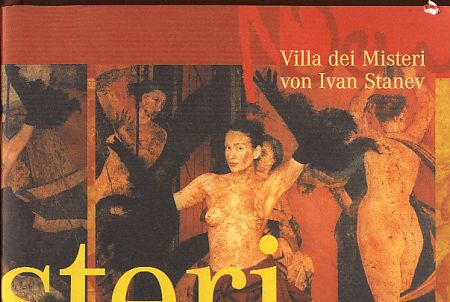
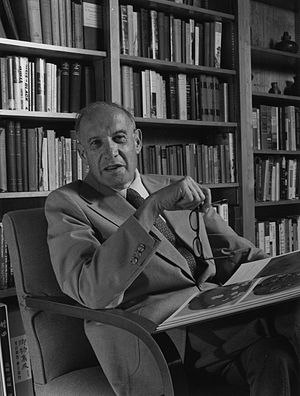

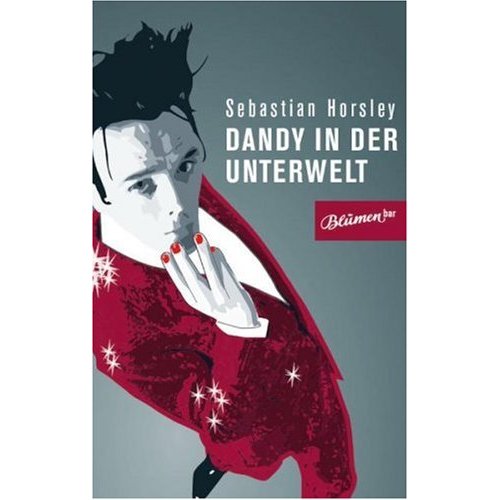 ,
,

